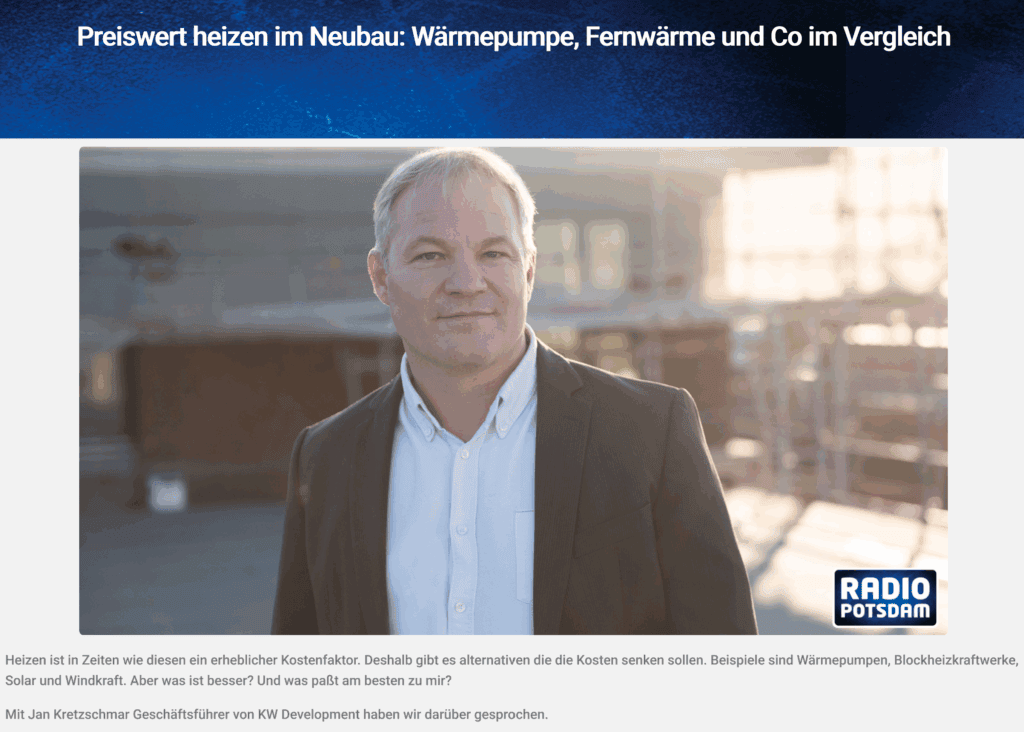Sobald es draußen kälter wird, machen sich viele Menschen wieder Gedanken über ihre Heizung und ihr Heizverhalten. Auch für uns Projektentwickler ist die Heizung ein sehr wichtiges Thema, über das wir uns das ganze Jahr über Gedanken machen. Eine gute Heizung soll günstig, sparsam und zuverlässig sein. Sie soll viele Jahre funktionieren und möglichst wenig Energie verbrauchen. Wer hier die richtigen Entscheidungen trifft, spart langfristig Geld und schützt das Klima. Denn eine Gastherme ist schon lange nicht mehr die einzige, geschweige denn die beste Wahl. Ein Heizsystem, das wir heute in den Keller stellen, muss auch in 20 Jahren noch sinnvoll sein.
Die Qual der Wahl: Luft, Erde oder doch das Abwasser?
Heute sind am Markt ganz unterschiedliche Systeme verfügbar, die sich in Bezug auf die Anschaffungskosten, die laufenden Kosten und die Umweltbilanz unterscheiden.
Die Luftwärmepumpe funktioniert ähnlich wie ein Kühlschrank, nur andersherum. Sie nimmt die Wärme aus der Umgebungsluft und wandelt sie in Heizenergie um. Ihr Vorteil sind die weite Verbreitung und die relativ günstigen Anschaffungskosten. Problem: Wenn es draußen richtig kalt wird – genau dann, wenn Sie die meiste Wärme brauchen – wird sie ineffizient. Der Stromverbrauch steigt, und damit die laufenden Kosten.

Die Erdwärmepumpe, die auf Geothermie basiert, ist eine Alternative. Sie nutzt die stabile Wärme tief im Boden, die in der Regel bei konstanten zwölf Grad liegt. Dafür müssen wir allerdings rund 100 Meter tief in die Erde bohren, was zunächst mit hohen Kosten verbunden ist. Der Vorteil liegt in ihrer höheren Effizienz. Aus einer Kilowattstunde Strom können bis zu vier Kilowattstunden Wärmeenergie gewonnen werden. Die Betriebskosten sind dadurch sehr niedrig. Ökologisch ist das eine sehr gute Lösung und meistens meine Lieblingsvariante für unsere Projekte. Am Ahornplatz in Babelsberg beheizen wir teils auf diese Weise das Hotel und unsere Studentenapartments. Über 60 Bohrungen waren erforderlich, um damit Heizung und Warmwasser zu versorgen. Der dafür nötige Strom wird von der Solaranlage auf dem Dach produziert.
Von Fernwärme haben viele sicher auch schon einmal gehört. Irgendwo gibt es dann einen großen Wärmeerzeuger, der die Wärme über ein Rohrnetz zu den Haushalten bringt. Das ist für den Bauherrn sehr bequem, denn man benötigt nur eine Übergabestation und spart sich die eigene Heizung. Zudem arbeitet das System nahezu wartungsfrei. Nachteil: Oftmals besteht ein Anschlusszwang und die Verbrauchskosten gehören nicht zu den günstigsten Optionen am Markt, speziell im Vergleich mit der Erdwärmepumpe. Auch wird Fernwärme heute überwiegend durch sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung gewonnen. Das ist die Abwärme aus Gaskraftwerken, die natürlich CO₂ ausstoßen. Immerhin arbeiten beispielsweise die Potsdamer Stadtwerke daran, die Fernwärme „grüner“ zu machen. Sie setzen auf Tiefen-Geothermie und bohren dafür 1.600 bis 1.800 Meter tief. Dort herrschen Temperaturen von bis zu 70 Grad. Das macht Fernwärme perspektivisch ökologischer. Unser Gewerbecampus am Flugplatz Strausberg wird beispielsweise komplett mit Fernwärme versorgt.

Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) erzeugt Strom und Wärme. Es ist im Prinzip ein kleines, dezentrales Kraftwerk. Die bei der Stromproduktion entstehende Wärme wird sinnvollerweise zum Heizen genutzt und nicht, wie oftmals in großen Kraftwerken, über Kühltürme in die Luft geblasen. Das steigert die Effizienz und arbeitet auch bei einer sogenannten Dunkelflaute, wenn also weder Sonne noch Wind zur Stromerzeugung zur Verfügung stehen. Es ist aber kein Modell für das Einfamilienhaus. Neu ist die Idee hingegen auch nicht. In der ehemaligen Heilanstalt in Beelitz wurden schon vor 125 Jahren auf diese Weise Wärme und Strom erzeugt. Und für unser dortiges Projekt haben wir im alten Heizkraftwerk ein neues, modernes BHKW eingebaut. So können wir das Quartier mit unserem eigenen Strom und unserer eigenen Wärme versorgen. Perspektivisch geht das auch CO₂-neutral, denn die Anlage kann mit Biomethan betrieben und auch komplett auf Wasserstoff umgerüstet werden.
Was eignet sich wofür?
Wie das bisher Geschriebene schon erahnen lässt, gibt es nicht die eine Technologie, die für alle Zwecke geeignet ist. Jedes System hat seine Stärken, und entscheidend ist immer, was an einem bestimmten Ort am besten funktioniert. Wir prüfen dabei sorgfältig, welche Energiequellen am Standort vorhanden sind, wie groß der Wärmebedarf ist und welche Fördermöglichkeiten genutzt werden können. Auch stabile laufende Kosten für die Bewohner spielen eine wichtige Rolle. Wenn all diese Punkte miteinander abgewogen sind, ergibt sich die optimale Lösung meist ganz von selbst.
Oft lohnt es sich auch, zusätzlich nach versteckten Potenzialen zu suchen. In Beelitz-Heilstätten zum Beispiel heizt der Supermarkt auf dem Gelände zu 80 Prozent mit der Wärme, die aus den Kühlanlagen stammt. So wird Energie, die sonst verloren ginge, clever wiederverwendet.

Bei unserem Projekt „Grüne Aue“ in Berlin-Biesdorf mussten wir uns etwas ganz Neues überlegen. Fernwärme war dort nicht verfügbar. Luftwärmepumpen wären zu laut gewesen, und Erdwärme durfte wegen des Trinkwasserschutzes nicht genutzt werden. Wir waren daher einer der ersten in Berlin, die die Wärme des Abwasserkanals angezapft haben. Wir haben in Absprache mit dem Wasserversorger Wärmetauscher in die Kanalwände gesetzt und nutzen die Restwärme des Wassers, das gerade im Winter deutlich wärmer als die Außenluft ist, um einen ganzen Häuserblock zu beheizen. Das System wird mit einem BHKW ergänzt. Nur wenn es besonders kalt ist, wird noch ein Brennwertkessel dazugeschaltet. So heizen wir 80 Häuser und 36 Wohnungen überwiegend mit der Wärme des Abwassers und sparen rund 25 Prozent CO₂, was etwa 22 Tonnen CO₂ pro Jahr entspricht.
Was können die Bewohner tun?
Unsere Neubauten erfüllen natürlich die aktuellen Energiestandards und sind entsprechend gedämmt und mit energiesparenden Fenstern ausgestattet. Oftmals erfüllen wir auch den früheren KfW-55 Standard. Nach meiner Erfahrung liegt der wesentliche Faktor für niedrige Energiekosten nicht bei der Frage, ob eine Fußbodenheizung oder eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut ist. Der entscheidende Faktor ist der Mensch. Wenn ich im Winter bei 23, 24 Grad im Wohnzimmer im T-Shirt sitzen möchte, wird meine Nebenkostenabrechnung relativ hoch ausfallen. Komme ich mit 20 Grad im Wohnzimmer zurecht, indem ich mir einen warmen Pulli anziehe, kann ich gut bis zu 30 Prozent der Energiekosten einsparen. Wenn ich zweimal täglich ausgiebig heiß dusche, ist das ein anderer Energieverbrauch als bei einer kurzen Dusche am Morgen, teilweise vielleicht mit kaltem Wasser. Der Geldbeutel wird es danken und gesund ist das nebenbei bemerkt ebenfalls. Keine gute Idee hingegen ist es, die Heizung komplett auszudrehen, wenn man das Haus verlässt. Gerade bei trägen Systemen wie der Fußbodenheizung dauert es Stunden, bis die Wärme wieder da ist, und man verbraucht dieselbe Energie, die man gerade eingespart hat, um die ausgekühlten Wände wieder aufzuwärmen.
Fazit
Mein abschließender Tipp: Wer heute in gute Technik investiert, spart langfristig Energie, Geld und tut gleichzeitig etwas fürs Klima. Schauen Sie daher beim Bau oder Kauf einer Immobilie nicht nur auf den Kaufpreis, sondern auch auf die Leistung und die Effizienz des Heizsystems. Wenn Sie eine Immobilie für 20 Jahre nutzen, rechnet sich die anfänglich höhere Investition in eine zukunftssichere und ökologische Heizung am Ende fast immer. Und fragen Sie Fachleute, etwa Energieberater oder den Bauherren-Schutzbund. Die sind geschult und haben oftmals ganz clevere Ideen.
Ihr Jan Kretzschmar
PS: Kürzlich habe ich bei Radio Potsdam auch über preiswertes Heizen gesprochen. Das Interview kann hier angehört werden: